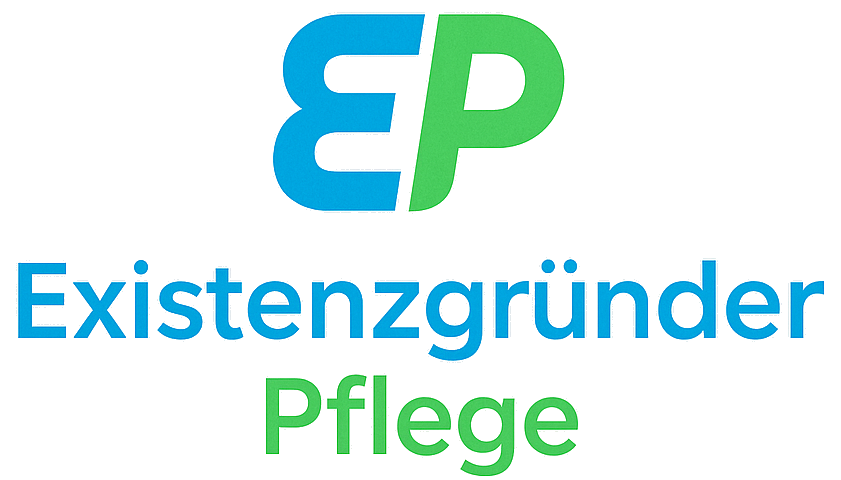Arbeitsbedingungen
Die ambulante Pflege erfordert von Mitarbeitenden ein hohes Maß an Flexibilität, Mobilität und Belastbarkeit. Ständige Ortswechsel, individuell unterschiedliche Wohnverhältnisse, Zeitdruck durch Wegezeiten, Parkplatzsuche oder Wetterbedingungen gehören zum Arbeitsalltag.
Diese Rahmenbedingungen erschweren eine gesunde und ergonomische Arbeitsweise erheblich – insbesondere da die Pflegefachkraft in den Wohnungen der Pflegebedürftigen lediglich Gast ist und Veränderungen oft nicht umsetzbar scheinen.
Lösungsansätze
Ziel muss es sein, durch strukturelle und zwischenmenschliche Maßnahmen die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. Dazu gehören:
• Ergonomische Bewertung der Wohnumgebung bereits beim Erstbesuch
• Schulung rückenschonender Arbeitsweisen und Einsatz technischer Hilfsmittel
• Optimierte Touren- und Dienstplanung mit realistischen Zeitpuffern
• Stärkung der Führungskompetenz und Kommunikation
• Anerkennung von Emotionsarbeit und psychischer Belastung
• Umsetzung eines strukturierten Hygienemanagements nach IfSG und ArbSchG
1. Einrichtung des Arbeitsplatzes „Wohnzimmer“
Pflege findet im ambulanten Bereich in privaten Haushalten statt. Die Bedingungen vor Ort sind oft beengt, unübersichtlich oder unstrukturiert – Pflegehilfsmittel fehlen oder sind unzureichend vorhanden. Das erschwert eine sichere und ergonomische Versorgung erheblich.
Bereits beim Erstbesuch sollte die Pflegedienstleitung die Umgebung hinsichtlich Ergonomie, Unfallrisiken und Arbeitsabläufen bewerten. Ziel ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und gemeinsam mit den Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen sinnvolle Veränderungen umzusetzen.
Dabei gilt: Veränderungen dürfen nicht als Eingriff in die Privatsphäre empfunden werden. Stattdessen sollte transparent kommuniziert werden, dass sichere und praktikable Bedingungen sowohl dem Pflegepersonal als auch den Pflegebedürftigen zugutekommen.
Argumente für Anpassungen:
• Gesunde Pflegekräfte leisten bessere Arbeit
• Stolperfallen vermeiden – auch für Pflegebedürftige
• Weniger krankheitsbedingte Ausfälle
• Einsatz technischer Hilfsmittel steigert Qualität und Sicherheit
• Entlastung für Pflegende durch rückenschonendes Arbeiten
Nach § 5 ArbSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, Gefährdungen zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden zu ergreifen. Dazu gehören:
• Beurteilung der Wohnumgebung und des Arbeitsplatzes
• Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Unfallvermeidung
• Dokumentation und regelmäßige Überprüfung bei Änderungen
Beispiele zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
• Entfernung von Stolperfallen: z. B. Teppichkanten sichern, Kabel abkleben, lose Gegenstände wegräumen
• Bewegungsfreiheit schaffen: Raumstruktur anpassen, Wege freihalten
• Ausreichende Beleuchtung sicherstellen: nicht im Dämmerlicht arbeiten
• Einsatz technischer Hilfsmittel: z. B. höhenverstellbare Pflegebetten, Patientenlifter, Gehwagen, Transferhilfen
• Ergänzende kleine Hilfsmittel nutzen: z. B. Bettleiter, Anti-Rutsch-Matte, Aufrichthilfe, Stecklaken, Gleitmatte
2. Immer die Haltung bewahren!
Körperlich belastende Arbeiten wie Heben, Umlagern oder Stützen von Pflegebedürftigen gehören zum Pflegealltag. Fehlende oder nicht genutzte Hilfsmittel sowie beengte Räume führen häufig zu einseitiger Belastung und Rückenschmerzen – bis hin zu Bandscheibenschäden.
Rückenschmerzen sind kein Berufsrisiko, mit dem man sich abfinden muss. Richtiges Verhalten, technische Hilfsmittel und ergonomische Bedingungen können gesundheitliche Schäden vermeiden.
Folgen ungesunder Arbeitsbedingungen:
• Anstrengende Zwangshaltungen (Bücken, Drehen, Tragen)
• Erschwerte Bewegungen durch vollgestellte Wohnungen
• Keine geeigneten Pflegebetten
• Fehlende kollegiale Unterstützung oder Zeitdruck
Prävention durch Schulung und Technik:
Pflegekräfte sollten zu Beginn ihrer Tätigkeit im rückenschonenden Arbeiten unterwiesen werden – etwa durch interne Fortbildungen, Kinästhetik-Kurse oder Rückenschulungen. Nur wer Belastungen kennt, kann sie vermeiden.
Bobath-Konzept
Das Bobath-Konzept nutzt die noch vorhandene Bewegungsfähigkeit pflegebedürftiger Menschen, um sie in Alltagsabläufe einzubeziehen. Dadurch verringert sich die körperliche Belastung für die Pflegekraft und gleichzeitig wird die Eigenaktivität des Pflegebedürftigen gefördert – vor allem bei neurologischen Erkrankungen.
Kinästhetik
Kinästhetik ist ein Bewegungskonzept, das Pflegekräften hilft, eigene Bewegungsressourcen zu nutzen und gleichzeitig die Mobilität von Pflegebedürftigen zu fördern. Es basiert auf Wahrnehmung, Berührung und Zusammenarbeit – nicht auf Kraft.
Hinweis: Rückenschonende Arbeitstechniken setzen voraus, dass die Arbeitsumgebung dies auch erlaubt. Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass technische Hilfsmittel in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und die Mitarbeitenden entsprechend geschult werden – gemäß § 5 und § 12 Arbeitsschutzgesetz.
Maßnahmen für rückenschonendes Arbeiten
1. Gesundheitsbewusstes Verhalten fördern:
• Regelmäßige Schulungen über rückenschonende Techniken und Pflegehilfsmittel (z. B. in Kooperation mit Sanita¨tsha¨usern)
• Fortbildungen zu Kinästhetik, Arbeitsorganisation und ergonomischen Bewegungsabläufen
• Teilnahme an Rückenschulen oder Gesundheitskursen
2. Gesunde Arbeitsverhältnisse schaffen:
• Ergonomische Arbeitsplatzanalyse im Haushalt
• Gezielter Einsatz technischer Hilfsmittel (z. B. Gleitmatten, Rutschhilfen, Transferbretter)
• Beratung der Angehörigen zur Umgestaltung des Wohnbereichs
• Bereitstellung passender Arbeitskleidung mit ausreichend Bewegungsfreiheit
Pflegebedürftige haben gemäß § 40 SGB XI Anspruch auf technische Pflegehilfsmittel. Diese dürfen zur Erleichterung der Pflege, zur Linderung von Beschwerden oder zur Ermöglichung einer selbstständigeren Lebensführung eingesetzt werden – bei Bedarf über die Pflegekasse.
3. Die Arbeit organisieren
Eine gute Organisation ist entscheidend für die Qualität der Pflege – und für die Gesundheit der Mitarbeitenden. Fehler in der Dienstplanung, Überlastung durch schlecht abgestimmte Touren oder fehlende Abstimmungen im Team führen schnell zu Frustration, Zeitdruck und unnötigem Stress.
Arbeitsorganisation bedeutet, Antworten auf folgende Fragen zu finden:
• Wer übernimmt welche Aufgabe?
• In welcher Reihenfolge und Zeitspanne?
• Mit welchen Ressourcen (Personal, Hilfsmittel)?
Die Struktur der Arbeitsabläufe muss im Qualitätsmanagement verankert sein. Planungsfehler – etwa das Übersehen eines Einsatzes – stellen einen gravierenden Qualitätsmangel dar.
Zu beachten bei der Touren- und Einsatzplanung:
• Individueller Pflegebedarf jedes Klienten
• Qualifikation und Verfügbarkeit des Personals (Teil-/Vollzeit)
• Arbeitszeitgesetz, Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz
• Einplanung von Besprechungen, Weiterbildungen, Pausen
• Berücksichtigung von Krankheit oder Ausfall (Vertretungsregelung)
• Möglichst kurze Wege und realistische Zeitpuffer
• Berücksichtigung der Mitarbeiterwünsche
Wichtig:
Alle Mitarbeitenden müssen ihre Aufgaben kennen und klar abgrenzen können. Es muss ihnen möglich sein, realistisch „Nein“ zu sagen, wenn Angehörige oder Pflegebedürftige zusätzliche Leistungen wünschen, die im vereinbarten Rahmen nicht enthalten sind.
Ein ausgewogener Mix aus schwer- und leichtpflegebedürftigen Klienten entlastet das Team. Lange Wegstrecken, Parkplatzsuche und unvorhersehbare Verzögerungen sollten bei der Tourenplanung berücksichtigt und reduziert werden.
Vorschläge für gesunde Arbeitszeitgestaltung:
• Tägliche Arbeitszeit möglichst auf max. 8 Stunden begrenzen
• Dienstbeginn frühestens ab 6:30 Uhr
• Mindestens 11 Stunden Ruhezeit zwischen zwei Einsätzen (gemäß ArbZG)
• Mindestens zwei zusammenhängende freie Tage pro Woche
• Nach Nachtdiensten mind. zwei Erholungstage einplanen
• Dienstpläne vorwärtsrotierend gestalten (Früh → Spät → Nacht)
• Rechtzeitige Dienstplanabstimmung im Vormonat
• Dienstübergaben, Kommunikation und Erreichbarkeit planen
Ein durchdachter, mitarbeiterfreundlicher Dienstplan trägt zur Motivation, Zufriedenheit und langfristigen Bindung bei.
4. Prima Klima – mit der richtigen Führung
Gute Führung ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in der ambulanten Pflege. Sie wirkt sich unmittelbar auf Motivation, Gesundheit und Bindung der Mitarbeitenden aus. Gleichzeitig reduziert sie Fluktuation, Krankheitsausfälle und Qualitätsprobleme.
Typische Aufgaben von Führungskräften:
• Strukturierte Arbeitsorganisation
• Klare Kommunikation & transparente Informationsflüsse
• Kontinuierliche Personalentwicklung
• Verankerung von Qualitäts- und Gesundheitsschutz im Alltag
Pflegekräfte müssen klare Aufgaben, Entscheidungsspielräume und eine faire Arbeitsverteilung erhalten. Nur wenn Mitarbeitende sich ernst genommen fühlen, entstehen Eigenverantwortung, Offenheit für Veränderung und Innovationsbereitschaft.
Mitarbeiterführung bedeutet auch:
• Aufgaben delegieren, damit Mitarbeitende sich entwickeln können
• Regelmäßige Einzel- und Teamgespräche
• Kommunikation auf Augenhöhe
• Beteiligung bei Einsatz- und Urlaubsplanung
Neue Mitarbeitende einarbeiten:
Eine gute Einarbeitung entscheidet über Integration, Motivation und Qualität der Arbeit. Das Einarbeitungskonzept sollte prüfbar dokumentiert und systematisch aufgebaut sein – vom ersten Tag bis zur aktiven Mitarbeit.
Inhalte eines Einarbeitungskonzepts:
• Vorstellung des Teams und der Einrichtung
• Einführung in Abläufe, Tourenpläne, Dokumentation, Dienstpläne
• Unterweisung zu Arbeitsschutz, Hygiene, Notfällen
• Schulung zur Nutzung von Formularen, Technik, Fahrzeugen
• Einblick in Unternehmenswerte und Pflegeleitbild
Ziel ist es, neue Mitarbeitende fachlich und menschlich zu integrieren – so entsteht Bindung, Motivation und eine hohe Pflegequalität.
Fortbildung & gesetzliche Unterweisungspflichten
Pflegekräfte stehen vor komplexen Anforderungen – fachlich, organisatorisch und zwischenmenschlich. Eine kontinuierliche Fortbildung ist deshalb unverzichtbar und gesetzlich verpflichtend.
Rechtsgrundlage:
• § 80 SGB XI: Qualitätssicherung in der Pflege
• GKV-Modernisierungsgesetz
• Arbeitsschutzgesetz (§ 12 ArbSchG)
• Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
Wichtige Fortbildungsthemen:
• Pflegeplanung & Pflegedokumentation
• Umgang mit dementiell veränderten Menschen
• Hygiene & Infektionsschutz
• Arbeitssicherheit & Notfallmanagement
• Wundmanagement & Prophylaxen
• Kommunikation, Gewaltprävention, Konfliktlösung
• Umgang mit Angehörigen
• Rechtliche Grundlagen (SGB V/XI, MD-Prüfung, Datenschutz)
Fortbildungsbedarf analysieren:
• Struktur der Klient:innen (z. B. gerontopsychiatrische Erkrankungen?)
• Versorgungsanteil mit Behandlungspflege (§ 37 SGB V)?
• Qualifikationsprofile und individuelle Entwicklungswünsche
Ein strukturierter Fortbildungsplan sichert Qualität, Motivation und gesetzliche Konformität – und wirkt nachhaltig positiv auf das Arbeitgeberimage.
5. Emotionsarbeit – psychische Belastungen erkennen und auffangen
Pflegekräfte begleiten Menschen in existenziellen Lebenssituationen – Krankheit, Hilflosigkeit, Schmerz, Scham, Sterben. Dabei entstehen intensive Gefühlslagen: Mitgefühl, Ärger, Hilflosigkeit, manchmal Ekel oder Wut. Diese Emotionsarbeit ist Teil des Berufs – aber sie belastet auf Dauer.
Herausforderung:
Pflegekräfte müssen professionell agieren, auch wenn sie emotional stark beansprucht sind. Zwischenmenschliche Konflikte, aggressive Patienten oder belastende Verlusterfahrungen können auf Dauer zu Überlastung führen – bis hin zum Burnout.
Burnout-Symptome:
• Emotionale Erschöpfung (innerlich „leer“, überreizt)
• Distanzierung (Depersonalisierung): Betroffene ziehen sich zurück
• Reduzierte Leistungsfähigkeit
Maßnahmen zur Prävention:
• Anerkennung der Emotionsarbeit als echte Leistung
• Regelmäßige Gespräche im Team, Supervision oder Coaching
• Schulungen zur Selbstfürsorge und Stressbewältigung
• Kollegiale Unterstützung und Austausch
• Ausgewogene Dienstpläne und Erholungspausen
Supervision & Coaching:
Supervision bietet professionelle Unterstützung für Pflegekräfte im Umgang mit belastenden Situationen. Sie fördert Reflexion, Austausch und Stärkung der beruflichen Rolle. Sie kann einzeln oder im Team erfolgen und ist ein wirksames Mittel gegen emotionale Erschöpfung und Fluktuation.
6. Hygienemanagement im ambulanten Pflegedienst
Hygiene schützt Mitarbeitende und Pflegebedürftige – vor Infektionen, unnötigen Ausfällen und Reputationsschäden. Ambulante Dienste sind verpflichtet, ein umfassendes Hygienemanagement nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben umzusetzen.
Gesetzliche Grundlagen:
• Infektionsschutzgesetz (IfSG)
• Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG)
• Biostoffverordnung (BioStoffV)
• DGUV Vorschrift 1 / TRBA 250
• Pflege-Qualitätssicherungsgesetz (§ 80 SGB XI)
Elemente des Hygienemanagements:
1. Erstellung und Umsetzung eines Hygieneplans
2. Überwachung der Hygienestandards und Infektionsprophylaxe
3. Gesundheitsschutz für Mitarbeitende (inkl. Impfungen, Unterweisung)
Inhalte eines Hygieneplans:
• Händehygiene, Desinfektionsstandards
• Schutzkleidung und Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen
• Wäschelogistik und Abfallentsorgung
• Umgang mit meldepflichtigen Infektionen (§§ 6 & 7 IfSG)
• Schulung und Dokumentation aller Maßnahmen
Pflichten des Arbeitgebers:
• Bereitstellung von Schutzkleidung, Handschuhen & Desinfektionsmitteln
• Organisation arbeitsmedizinischer Vorsorge nach BioStoffV
• Immunisierungsangebote für Risikogruppen (z. B. Hepatitis, Influenza)
• Regelmäßige Hygieneschulungen (§ 12 ArbSchG)
• Meldung bei Verdacht auf meldepflichtige Infektionskrankheiten
Fazit:
Ein strukturiertes Hygienemanagement ist Pflicht – und eine Investition in die Sicherheit aller Beteiligten. Die Verantwortung trägt die Pflegedienstleitung, unterstützt von Hygienebeauftragten und ggf. dem Betriebsarzt oder Gesundheitsamt.